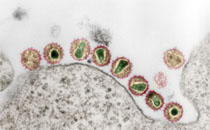Krankentransport und Rettungsdienst
Welche Beratung kann das RKI zur Beantwortung von Fragen aus dem Bereich Krankentransport und Rettungsdienst anbieten?
Typische Fragestellungen
Inhaltliche Schwerpunkte betreffen meist Erkrankungen und Krankheitserreger,
- die bei der stationären Versorgung besondere Maßnahmen erfordern (als da z.B. sind: MRSA, C. difficile, ESBL-Bildner, Meningokokken)
- oder wo der Arbeitsschutz eine besondere Schutzausrüstung verlangt oder eine Schutzimpfung empfohlen ist, um auf den Rettungsmitteln Tätige vor berufsbedingten Erkrankungen zu schützen (z.B. Tuberkulose, Hepatitis A, Pertussis).
- Ein dritter Fragenkomplex betrifft Maßnahmen bei meist jahreszeitlich gehäuft auftretenden (epidemischen) Erkrankungen wie Noroviren oder Influenza.
Regelwerke und rechtlicher Rahmen
Die Bitten in den Anfragen stellen meist „Bestimmungen, gesetzliche Regelungen, Vorschriften, Richtlinien“ ganz in den Vordergrund. Dass dafür das Robert Koch-Institut (RKI) bemüht wird, ist verständlich aber nicht ganz der richtige Weg, weil das RKI nicht der Gesetzgeber und auch keine Fachbehörde ist, die Sanktionen durchsetzen kann.
Da so häufig das Recht bemüht wird und in Anfragen offen erkennbar ist oder zumindest zu vermuten ist, dass dem vorgetragenen Sachverhalt ein Konflikt zugrunde liegt, bedarf es weniger Bemerkungen zur Klarstellung:
Gefahrenabwehr bei meldepflichtigen Erkrankungen(§§ 17/18 IfSG)
In § 17 IfSG wird geregelt, dass in den Fällen, in denen Gegenstände mit meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet sind oder wenn das anzunehmen ist und dadurch eine Verbreitung der Krankheit zu befürchten ist, die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der hierdurch drohenden Gefahren zu treffen hat.
Eine solche Gefährdungssituation kann jedoch dann gar nicht erst entstehen, wenn geschultes Personal durch geeignete Maßnahmen (z.B. durch Reinigung und Desinfektion) Oberflächen vor Kontamination schützt und so das Rettungsmittel für den nächsten Einsatz vorbereitet.
§ 18 IfSG beschreibt die Voraussetzungen zur Erstellung der amtlichen Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes und bestimmt darüber hinaus in Abs. 1, dass bei behördlich angeordneten Entseuchungen … nur Mittel und Verfahren anzuwenden sind, die von der zuständigen Behörde in einer Liste …. bekannt gemacht worden sind (www.rki.de ). Allein durch eine genaue Lektüre der beiden zitierten Vorschriften wird deutlich, dass es keinen gesetzlich vorgesehenen Automatismus gibt, dass nach einem „Infektionstransport“ nur Mittel und Verfahren nach der sog. RKI-Liste mit der dort genannten Einwirkzeit von vier Stunden anzuwenden seien. Die besonderen Prüfbedingungen, die die Voraussetzung für die Listung von Flächendesinfektionsmitteln darstellen (siehe Vorwort zur Liste), machen deutlich, dass die Angaben in der Liste insbesondere auf gezielte Desinfektionsverfahren bei organischen Verunreinigungen abzielen und besonders widerstandsfähige Mikroorganismen (z.B. Mycobakterien) berücksichtigen.
Für den Routinefall geprüfte und als wirksam befundene Verfahren sind z.B. in der Desinfektionsmittelliste des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH) zusammengestellt (vah-online.de; diese Publikation ist allerdings kostenpflichtig). Mittel und Verfahren nach „RKI-Liste“ sind folglich nur anzuwenden, wenn seitens des Unternehmers das Gesundheitsamt eingeschaltet und von dort entschieden wurde, dass aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles Mittel oder Verfahren der amtlichen Liste zum Einsatz kommen müssen.
Länderhoheit für die Gesetzgebung im Rettungsdienst
Krankentransport und Rettungsdienst ist nach der verfassungsmäßigen Ordnung Ländersache und dort durch eigene Gesetze geregelt. Sofern im Einzelfall dem Recht Geltung zu verschaffen ist – dies ist bei Meinungsverschiedenheiten, Konflikten oder schlicht bei fachlichem Dissens durchaus erforderlich – kann nur die für den Rettungsdienst benannte Fachbehörde (z.B. das Gesundheitsamt) oder auch die Aufsichtsbehörde eine Entscheidung herbeiführen. Stellungnahmen aus dem RKI sind dazu nur bedingt geeignet, weil diese fachlich begründeten Äußerungen für niemanden rechtlich bindend sind. Vielmehr kann der Hinweis durch eine der „streitenden Parteien“, man habe sich beim RKI vergewissert, eher zu einer Verhärtung denn Entspannung der Sachlage beitragen, weil der „heimlich“ eingeholte Wissensvorsprung eher zur Skepsis denn zu Einsichten beiträgt.
Die angesprochene Transparenz lässt sich am besten durch Offenlegung der herangezogenen Informationen im fachlichen Dialog erreichen, also dann, wenn unterschiedliche Auffassungen erstmals aufeinandertreffen und nicht erst dann, wenn eine Vielzahl von Argumenten bereits ausgetauscht ist und von einer Seite ein Schiedsrichter präsentiert wird, der offensichtlich nicht allgemein akzeptiert ist, weil er von einer Partei einseitig und nicht gemeinsam bestellt wurde.
Praktische Hinweise zum Vorgehen, wie Antworten auf Fragen selbst erarbeitet werden können
Auf der Startseite des Themenbereichs „Krankenhaushygiene“ sind praktische Hinweise und ein Wegweiser für Fragesteller zusammengestellt, wie Antworten selbst erarbeitet werden können.
Für Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst noch einmal das Wesentliche in Kürze:
- Die Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention enthält keine bereichsspezifischen Empfehlungen für den Rettungsdienst. Ein solches Dokument gehört auch derzeit nicht zum Arbeitsplan der Kommission beim RKI.
- Es können aber Empfehlungen immer dann herangezogen werden, wenn deren Aussagen für den Rettungsdienst relevant sind, denn die Richtlinie formuliert Empfehlungen für alle Einrichtungen im Gesundheitswesen.
- Wichtige Dokumente sind z.B.: Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen, zur Händehygiene, die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.
- Empfehlungen zur Postexpositionsprophylaxe gehören zum Aufgabenbereich der Ständigen Impfkommission (STIKO). Deren Empfehlungen sind beim Themenbereich „Impfen“ hinterlegt.
- Ein dritter – sehr ergiebiger Themenbereich – ist der mit den Ratgebern/Merkblättern für Ärzte. Diese enthalten Hinweise zu (oft nachgefragten) Übertragungswegen, zur Therapie und zu Schutzmaßnahmen.
- Für den Themenbereich „Krankenhaushygiene“ werden die Ratgeber ergänzt durch das Stichwort „Informationen zu ausgewählten Erregern“ (wie z.B. C. difficile, ESBL-Bildner, Noroviren, Influenza).
Mit den in den Fundstellen hinterlegten Informationen lassen sich in der Regel bereichsspezifische Hygienepläne und Handlungsanweisungen erarbeiten.
nach oben