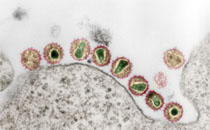Aufgaben und Methodik
Die Ständige Impfkommission (STIKO) entwickelt Impfempfehlungen für Deutschland und berücksichtigt dabei nicht nur deren Nutzen für das geimpfte Individuum, sondern auch für die gesamte Bevölkerung. Die STIKO orientiert sich dabei an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Während für die Zulassung einer Impfung deren Wirksamkeit (zumeist im Vergleich zu Placebo), deren Unbedenklichkeit und pharmazeutische Qualität relevant sind, analysiert die STIKO darauf aufbauend neben dem individuellen Nutzen-Risiko-Verhältnis auch die Epidemiologie auf Bevölkerungsebene und die Effekte einer flächendeckenden Impfstrategie für Deutschland. Außerdem entwickelt die STIKO Kriterien zur Abgrenzung einer üblichen Impfreaktion von einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung. STIKO-Empfehlungen gelten als medizinischer Standard.
Für die Entwicklung einer neuen Impfempfehlung bewertet die STIKO die hierzu verfügbare Evidenz vollständig und sehr genau und orientiert sich in diesem Prozess an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Dabei bedient sich die STIKO einer Standardvorgehensweise, die eine hohe wissenschaftliche Qualität der Empfehlung sicherstellt, interessensgeleitete Einflüsse minimiert und zu einer hohen Transparenz und damit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Entscheidung führt. Das ist auch notwendig, da die Empfehlungen der STIKO – im Gegensatz zu den Aussagen einzelner Wissenschaftler – weitreichende Konsequenzen haben. So entscheidet die Aufnahme in die STIKO-Empfehlungen, ob eine Impfung als Standard-Impfung für Millionen von Menschen oder für besondere Risikogruppen eingesetzt werden soll. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) entscheidet auf Grundlage der STIKO-Empfehlungen, ob eine Impfung in die Schutzimpfungsrichtlinie aufgenommen und damit zur Pflichtleistung der Gesetzlichen Krankenkassen wird. Damit entscheidet sich also, ob die Gemeinschaft der Beitragszahler für die Kosten dieser präventiven Maßnahme aufkommen soll.
Während bei der Zulassung eines neuen Impfstoffs die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des jeweiligen Impfstoff-Produkts im Vordergrund stehen, entscheidet die STIKO, wie eine zugelassene Impfung am sinnvollsten in der Bevölkerung zur Anwendung kommt. Daher geht die Bewertung der STIKO über eine individuelle Risiko-Nutzen-Bewertung hinaus und schätzt auch potenzielle Auswirkungen einer Impfung auf der Bevölkerungsebene ab.
Grundlagen einer STIKO-Impfempfehlung sind neben der Bewertung von Daten zur Krankheitslast insbesondere systematische Literaturrecherchen und Evidenzbewertungen zu Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung. Dabei können unter Umständen auch Daten aus (Beobachtungs-) Studien nach der Impfstoff-Zulassung berücksichtigt werden. Zusätzlich muss üblicherweise ein mathematisches Modell entwickelt werden, um die epidemiologischen und gesundheitsökonomischen Folgen einer Impfempfehlung abschätzen zu können. Außerdem beschäftigt sich die STIKO ausführlich mit Fragen der Implementierung und Akzeptanz der Impfung in der Bevölkerung, sowie mit den Möglichkeiten der Evaluation (z.B. ob Systeme bestehen bzw. etabliert werden müssen, mit denen die Wirksamkeit der Impfung oder der Rückgang der Erkrankung, vor der die Impfung schützen soll, in der Bevölkerung gemessen werden kann).
Daher ist die Erarbeitung einer neuen Impfempfehlung zeit- und arbeitsaufwändig. Eine systematische Literaturrecherche, bei der umfassend alle zu diesem Thema weltweit existierende Literatur gesichtet und von mindestens zwei Personen unabhängig voneinander bewertet wird, nimmt mindestens 6 Monate, meist jedoch mehr als ein Jahr in Anspruch; auch die Erarbeitung eines mathematischen Modells benötigt mindestens ein Jahr. Daher dauert die Erarbeitung einer neuen STIKO-Impfempfehlung im Durchschnitt zwischen ein und drei Jahren.
Liegt ein Beschlussentwurf der STIKO vor, haben betroffenen Fachkreise im Rahmen eines Stellungnahmeverfahrens laut GO der Kommission die Möglichkeit, Anmerkungen und Kommentare aus ihrer Sicht zu geben. Wenn fachliche Einwände geltend gemacht werden, kann in Folge die erneute Beratung des Themas auf der nächstfolgenden STIKO-Sitzung erforderlich sein. Stellungnahmeverfahren für STIKO-Beschlüsse benötigen i.d.R. einen Zeitrahmen von ca. 5 bis 6 Monaten.
Die STIKO ist ein unabhängiges Expertengremium, dessen Tätigkeit von der Geschäftsstelle im Fachgebiet Impfprävention des Robert Koch-Institut koordiniert und beispielsweise durch systematische Analysen der Fachliteratur unterstützt wird. Ziel ist es, die Impfempfehlungen an neue Impfstoffentwicklungen und Erkenntnisse aus der Forschung optimal anpassen zu können.
Die STIKO wurde im Jahr 1972 beim damaligen Bundesgesundheitsamt eingerichtet. Aufgrund der Bedeutung ihrer Impfempfehlungen wurde sie mit dem Infektionsschutzgesetz im Jahr 2001 gesetzlich verankert. Seit dem Jahr 2007 sind die von der STIKO empfohlenen Impfungen Grundlage für die Schutzimpfungsrichtlinie (SI-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und werden mit Aufnahme in die SI-RL Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland.
Entwicklung von Impfempfehlungen
Die STIKO bewertet kontinuierlich Daten zu Impfstoffen und impfpräventablen Erkrankungen. Bei der Bewertung von Daten und der Erarbeitung von Impfempfehlungen folgt die STIKO in wesentlichen Punkten der systematischen Methodik der Evidenzbasierten Medizin (EbM). In den letzten Jahren hat die STIKO im Rahmen einer Arbeitsgruppe ihre Methodik, auch im Austausch mit nationalen und internationalen Experten, diskutiert. So fanden zwei internationale Workshops statt, die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) finanziert wurden. Im November 2011 wurde von der STIKO eine aktualisierte Version ihrer allgemeinen methodischen Vorgehensweise beschlossen.
Im August 2013 startete ein vom BMG finanziertes Projekt, in dem das RKI und die STIKO mit nationalen und internationalen Experten Methoden zur Durchführung und Berücksichtigung von Modellierungen zur Vorhersage epidemiologischer und gesundheitsökonomischer Effekte von Impfungen erarbeitet haben. Auf ihrer 83. Sitzung hat die STIKO beschlossen, aufbauend auf medizinisch-epidemiologischen Analysen (Risiko-Nutzen-Bewertung) bei Bedarf auch Modellierungen und gesundheitsökonomische Evaluationen durchzuführen, um nicht nur effektive, sondern auch effiziente Impfstrategien entwickeln und deren Effekte sowohl auf die Krankheitsepidemiologie als auch auf die Kosten im Gesundheitssystem bzw. in der Gesellschaft prüfen zu können.